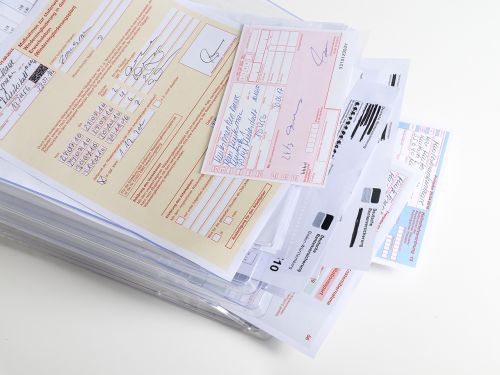Palliative Versorgung: Organisation, Ansprechpartner, rechtliche Informationen
Gut versorgt bei schwerer Erkrankung
- In der Palliativmedizin kümmern sich Ärztinnen und Ärzte um sehr schwer erkrankte Menschen mit begrenzter Lebenserwartung.
- Für die betroffenen Patientinnen und Patienten stellen sich in dieser Phase der Erkrankung viele Fragen: Wo möchte ich versorgt werden – zu Hause oder in einem Hospiz? Wer kümmert sich um mich? Und wer trifft medizinische und rechtliche Entscheidungen, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin?
- Der folgende Text soll als Hilfestellung für alle dienen, die wegen einer fortschreitenden Krebserkrankung auf der Suche nach Informationen und Ansprechpersonen sind. Ebenfalls aufgeführt sind Hinweise zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.
Hinweis: Die Auflistung bietet eine allgemeine Übersicht, nützliche Links und Kontakte. Ansprechpersonen vor Ort können Sie außerdem über die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, über Kliniksozialdienste, die eigene Krankenversicherung oder regionale psychosoziale Krebsberatungsstellen erfragen.
Palliative Versorgung und häusliche Krankenpflege organisieren
Palliativmedizin: Bereich der Medizin, der sich der ganzheitlichen Behandlung und Betreuung von Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung widmet. Das Augenmerk liegt auf der Linderung von Schmerzen und anderen Beschwerden sowie auf der unterstützenden Begleitung des Patienten entsprechend seiner Bedürfnisse.
Auch sehr schwer erkrankte Patientinnen und Patienten müssen nicht unbedingt ins Krankenhaus. Sie können sich bei entsprechender fachlicher Betreuung zu Hause versorgen lassen: Die Versorgung übernehmen dann Hausärzte oder Fachärzte sowie qualifizierte Pflegedienste.
Für Schwerkranke gibt es die "spezialisierte ambulante Palliativversorgung" (SAPV): Hier arbeiten feste Teams aus Ärztinnen oder Ärzten und Pflegefachleuten zusammen. Bei diesen sogenannten "Palliative Care-Teams" ist sichergestellt, dass rund um die Uhr jemand erreichbar ist. Bei Bedarf können noch weitere Fachleute und spezialisierte Dienste einbezogen werden, etwa ambulante Hospizdienste oder Psychoonkologinnen und Psychoonkologen.
Palliativstationen gehören dagegen zum Bereich der stationären Versorgung im Krankenhaus: Ihre Aufgabe ist es daher, Patientinnen und Patienten so gut zu versorgen und zu behandeln, dass sie möglichst wieder nach Hause entlassen werden können.
Hospize und Pflegeheime: Für Sterbende in der letzten Lebensphase, die nicht betreut werden können, gibt es auch die Möglichkeit, sich in einem Hospiz versorgen zu lassen. Je nach Situation kommt eventuell auch ein Pflegeheim infrage.
Wer trägt die Kosten?
Bei Fragen zur Kostenübernahme und zu möglichen Zuzahlungen können sich Betroffene und ihre Angehörigen an die behandelnden Ärzte und die zuständige Krankenversicherung wenden. Kliniksozialdienste und Mitarbeitende der regionalen Krebsberatungsstellen helfen bei der Klärung sozialrechtlicher Fragen ebenfalls weiter.
Ein Überblick:
- Die Betreuung auf der Palliativstation eines Krankenhauses gilt als stationäre Behandlung und wird wie diese abgerechnet.
- Pflege und Betreuung zuhause sowie die SAPV fallen unter die "häusliche Krankenpflege", die die behandelnden Ärzte bei Bedarf verordnen.
- Die Kosten für eine Unterbringung in einem Hospiz werden von den Krankenkassen übernommen. Bei der Einbeziehung von weiteren Betreuern oder bei der Unterbringung in einem Pflegeheim sollte folgendes geklärt sein: Was übernimmt die Krankenversicherung? Was übernimmt bei anerkanntem Pflegegrad eventuell die Pflegeversicherung? Und was muss man selbst zuzahlen?
Weitere Informationen
Das Bundesministerium für Gesundheit bietet auf seinen Internetseiten allgemeine Hintergründe:
Versorgung von schwerstkranken Menschen und Sterbenden (Palliativversorgung)
Zum Laden und Ausdrucken
Informationsblatt "Fortgeschrittene Krebserkrankung" (PDF)
Informationsblatt "Sozialrecht und Krebs: Wer ist wofür zuständig?" (PDF)
Palliativmedizin in Deutschland: Anlaufstellen, Organisationen und Dachverbände
Die folgende Aufzählung nennt bundesweit tätige Institutionen. Einige der aufgeführten Organisationen verfügen zudem über eine Auflistung oder eine Suchmöglichkeit, mit der man auch direkt Ansprechpersonen vor Ort finden kann.
Einen guten Überblick bietet der Wegweiser Hospiz und Palliativversorgung Deutschland:
- Das Verzeichnis ermöglicht die Suche nach Adressen vor Ort. Es enthält ambulante und stationäre Hospizeinrichtungen, Palliativstationen, SAPV-Teams, Palliativdienste im Krankenhaus und weitere Organisationen, Einrichtungen und Dienste im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland.
- Nicht aufgeführt sind dagegen Einrichtungen oder Dienste, die allgemein auf Pflege spezialisiert sind.
- Die Online-Version wird laufend ergänzt und ist inzwischen nicht nur auf Deutsch, sondern auch in vielen anderen Sprachen abrufbar.
- Verantwortlich für das Angebot ist die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP): Die DGP ist die Fachgesellschaft für alle Berufsgruppen, die sich mit der Behandlung, Beratung und Pflege schwer und chronisch kranker Menschen befassen. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich Palliativmedizin sowie der Aufbau eines nationalen und internationalen Netzwerkes zum Wissensaustausch. Die DGP finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge von Privatpersonen und industrielle Fördermitgliedschaften.
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV): Aufgabe des gemeinnützigen Vereins ist die bundesweite Interessenvertretung der Hospizbewegung in Deutschland. Die Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz (LAG) beziehungsweise die Hospiz- und Palliativverbände (LV) der 16 Bundesländer sind Mitglieder des DHPV. Der Verband und die entsprechenden Landesarbeitsgemeinschaften bieten vielfältige Informationen für Betroffene und Fachleute. Der DHPV finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Bundesverband Kinderhospiz e.V.: Der Verein ist der Dachverband für ambulante und stationäre Kinderhospize. Der Verband sieht seine Aufgabe darin, die gesamte Familie schwer erkrankter Kinder, Jugendlicher und auch junger Erwachsener zu unterstützen. Der Bundesverband bietet auf seinen Internetseiten eine Adressliste mit Ansprechpartnern der ambulanten Kinderhospizdienste und der stationären Kinderhospize.
- Ein besonderes Angebot ist Frag-OSKAR.de, das Hilfe-Portal des Bundesverband Kinderhospiz e.V. Über das OSKAR Sorgentelefon berät und informiert der Bundeverband zu allen Fragen, die mit lebensverkürzend erkrankten Kindern zu tun haben. Es ist gedacht für betroffene Kinder, deren Eltern, Geschwister und Freunde, aber auch für Fachkräfte der Palliativpflege.
Der Bundesverband Kinderhospiz wird durch zahlreiche Firmen, Vereine und Organisationen in seiner Arbeit unterstützt.
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und weitere Regelungen

Patientinnen und Patienten haben das Recht auf Selbstbestimmung. Das gilt auch für Behandlungssituationen, in denen sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern – beispielsweise, weil sie im Koma liegen oder eine Hirnschädigung erlitten haben.
Um das zu ermöglichen, können Patientinnen oder Patienten vorsorglich ihre Wünsche zur Behandlung, Unterbringung und Versorgung mitteilen. Eine solche "vorsorgliche Willenserklärung" kann dafür sorgen, dass die Wünsche der Betroffene auch und gerade dann berücksichtigt werden, wenn sie diese selbst nicht mehr unmittelbar zum Ausdruck bringen können.
Wichtig zu wissen
- Ehepaare oder Paare in eingetragener Lebenspartnerschaft: Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit über das Notvertretungsrecht zeitlich begrenzt medizinische Entscheidungen füreinander zu treffen. In anderen Belangen, beispielsweise Vermögensfragen, können Sie hingegen nicht einfach füreinander entscheiden.
- Kinder: Kinder dürfen nicht automatisch für ihre Eltern entscheiden und Eltern nicht für ihre erwachsenen Kinder.
Sie wollen sicherstellen, dass eine Person für Sie so entscheidet, wie Sie sich das selbst wünschen? Dann bedarf es dafür eine rechtlich verbindliche Erklärung.
Aus der vorsorglichen Willenserklärung muss hervorgehen,
- wer für die einwilligungsunfähige Person entscheiden soll und auch
- in welchem Lebensbereich, in welchem Umfang und auch mit welchem Inhalt oder Grundgedanken diese Person entscheiden soll.
Im Laufe einer längeren Erkrankung können sich die medizinischen und die persönlichen Einschätzungen ändern. Deshalb ist es jederzeit möglich eine bestehende vorsorgliche Willenserklärung zu ändern oder sich selbst anders zu entscheiden, als man es in der vorsorglichen Willenserklärung verfügt hat.
Es gibt 3 verschiedene Grundformen der vorsorglichen Willenserklärung:
- die Patientenverfügung
- die Betreuungsverfügung
- die Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
In der Patientenverfügung legt eine Patientin oder ein Patient vorsorglich fest, welche medizinischen Maßnahmen in einer bestimmten Situation durchzuführen oder zu unterlassen sind.
Eine Patientenverfügung stellt sicher, dass Ärzte und Pflegende den Patientenwillen umsetzen, wenn die oder der Erkrankte in medizinischen Angelegenheiten entscheidungsunfähig ist und Wünsche nicht mehr äußern kann.
Darauf sollten Sie als Krebspatientin oder Krebspatient bei einer Patientenverfügung achten:
- Gehen Sie so genau wie möglich auf Behandlungsmöglichkeiten und Ihre damit verbundenen Behandlungswünsche ein.
- Legen Sie dabei so detailliert wie möglich fest, welchen Behandlungsschritten Sie zustimmen und welchen nicht. Das betrifft beispielsweise künstliche Ernährung, Beatmung, Wiederbelebung oder Schmerzbehandlung.
- Sprechen Sie mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten über eine geplante oder bestehende Patientenverfügung. Sie können die aktuelle Situation und den weiteren Verlauf der Erkrankung medizinisch am besten einschätzen und beurteilen, ob die zu treffenden Behandlungsentscheidungen alle abgedeckt sind.
Eine vorher bestimmte, betreuende Person hat die Aufgabe, die Patientenverfügung umzusetzen. Man kann die betreuende Person in der Patientenverfügung selbst, in einer Betreuungsverfügung oder in einer Vorsorgevollmacht bestimmen. Ist keine Person bestimmt worden, kann das Krankenhaus anregen, über das Betreuungsgericht eine betreuende Person anordnen zu lassen.
Was, wenn keine Patientenverfügung vorliegt? Dann muss die betreuende Person
- die Behandlungswünsche oder den wahrscheinlichen (mutmaßlichen) Willen des Betreuten feststellen und
- auf Grundlage des mutmaßlichen Willens der oder des Betroffenen entscheiden, ob er oder sie in eine ärztliche Maßnahme einwilligt oder nicht.
- Konkrete Anhaltspunkte für den mutmaßlichen Willen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen (beispielsweise gegenüber Angehörigen oder im Freundeskreis), ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Die persönlichen Wertvorstellungen der Betreuerin oder des Betreuers sind dabei unerheblich.
Betreuungsverfügung
In einer Betreuungsverfügung kann eine Patientin oder ein Patient einen Wunsch äußern, welche Person die gesetzliche Betreuung übernehmen soll, wenn es erforderlich werden sollte.
Genauso können Menschen in einer Betreuungsverfügung bestimmen, wer auf keinen Fall Betreuer oder Betreuerin sein soll.
Möglich sind auch inhaltliche Vorgaben, etwa welche Wünsche und Gewohnheiten respektiert werden sollen oder ob im Pflegefall eine Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim gewünscht wird.
In der Regel wird das Betreuungsgericht den Wunsch in der Betreuungsverfügung umsetzen.
Vorsorgevollmacht
Bevollmächtigen Sie in Ihrer Vorsorgevollmacht nur eine Person, der sie uneingeschränkt vertrauen und von der Sie überzeugt sind, dass sie nur in Ihrem Sinne handeln wird.
Mit der Vorsorgevollmacht kann eine Person einer anderen das Recht einräumen, in ihrem Namen stellvertretend zu handeln.
Die Vorsorgevollmacht kann für alle Lebensbereiche gelten. Das bezeichnen viele auch als "Generalvollmacht". Oder sie kann für bestimmte Lebensbereiche gelten, beispielsweise Finanzen oder Gesundheitsangelegenheit:
- Die Vollmacht kann dabei an eine oder mehrere Personen erteilt werden.
- Die Vollmacht bestimmt, wie die bevollmächtigte Person in den dort geregelten Bereichen handeln soll.
Medizinische Notvertretung
Das Notvertretungsrecht ermöglicht zukünftig zeitlich begrenzt medizinische Entscheidungen für den Partner oder die Partnerin zu treffen, wenn er oder sie nicht dazu in der Lage ist – etwa aufgrund von Bewusstlosigkeit.
Voraussetzungen für die Notvertretung: Das Notvertretungsrecht gilt nur für Verheiratete und eingetragene Lebenspartnerschaften. Für alle anderen gilt das Notvertretungsrecht nicht.
Eine Notvertretung ist zudem nur möglich, wenn ...
- die Gesundheitsvorsorge nicht anderweitig geregelt ist, zum Beispiel durch eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht.
- beide nicht getrennt leben.
- die Ärztin oder der Arzt weiß, dass sie nicht gegen den Willen der Partnerin oder des Partners ist.
Eine Ärztin oder ein Arzt muss in einem entsprechenden Formular schriftlich bestätigen, dass die Voraussetzungen für die Notvertretung vorliegen und ab wann sie beginnt.
Das Notvertretungsrecht hebt vor allem die ärztliche Schweigepflicht auf. Menschen in einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft können im Notfall ...
- eine ärztliche Aufklärung für ihre Partnerin oder ihren Partner erhalten.
- in medizinische Untersuchungen, Therapien und Eingriffe einwilligen.
- für ihre Partnerin oder ihren Partner mit Dritten kommunizieren und gegebenenfalls Anträge stellen.
- Verträge zu gesundheitlichen Angelegenheiten abschließen.
Wichtig zu wissen: Die medizinische Notvertretung ist zeitlich begrenzt auf maximal 6 Monate. Außerdem gilt sie nur für gesundheitliche Entscheidungen und nicht in Vermögensfragen. Das Notvertretungsrecht kann also keinesfalls eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht ersetzen, die langfristige Regelungen für medizinische Notfälle festlegt.
Beratung und Quellen zur vorsorglichen Willenserklärung
Lassen Sie sich nur bei rechtlich und medizinisch qualifizierten Stellen informieren und beraten.
Wenn Sie Vordrucke und Muster verwenden, sollten diese aktuell sein und aus einer zuverlässigen Quelle stammen.
In diesem Abschnitt unterstützen wir Sie dabei, seriöse Ansprechpersonen und Quellen zu finden.
Die folgenden Ansprechpartner beraten in der Regel zu allen 3 Formen der vorsorglichen Willensbekundung. Denn es ist wichtig, dass die Inhalte der Verfügungen miteinander übereinstimmen und keine Widersprüche bestehen.
- Kommunale Betreuungsbehörden (Betreuungsstellen): Sie sind Teil der Gemeindeverwaltung und können beim zuständigen Bürgeramt oder der Gemeinde am Wohnort erfragt werden.
- Rechtlich anerkannte Betreuungsvereine: Adressen von Betreuungsvereinen vor Ort nennt die Betreuungsbehörde, das Bürgeramt oder Wohlfahrtseinrichtungen vor Ort.
- Verschiedene Organisationen bieten eine kostenfreie telefonische Erstinformation oder Basisberatung. Für weitergehende Hilfen zur Erstellung und/oder Prüfung von Vorsorgedokumenten setzen sie jedoch eine Mitgliedschaft oder eine Bezahlung voraus. Beispiele sind der Humanistische Verband Deutschlands (HVD), eine Vereinigung religionsfreier Personen und Interessensverbände oder die Deutsche Stiftung Patientenschutz.
- Notare und Rechtsanwälte sind Ansprechpersonen, wenn man Verfügungen und Vollmachten erstellen möchte. Der Gang zur Notarin oder zum Notar empfiehlt sich vor allem dann, wenn ein Grundstück oder eine Immobilie vorhanden ist, da hier in der Regel eine notarielle Beurkundung erforderlich ist. Die Kosten richten sich nach der Gebührenordnung für Notare oder bei Rechtsanwälten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Betroffene sollten vorab nach den voraussichtlichen Kosten fragen.
In Folgenden finden Sie kostenlose seriöse Quellen zu Informationen, Vordrucke und Muster für Verfügungen und Vollmachten. Die Auflistung stellt eine Auswahl dar und bietet keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
- Bundesministerium der Justiz (BMJ): Das BMJ bietet gut verständliche Informationen, kostenlose Broschüren – auch in Leichter Sprache – und Vordrucke rund um das Thema Betreuungsrecht.
- Bayerisches Staatsministeriums der Justiz: Hier erhalten Sie die Broschüre "Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter", die kostenlos als PDF heruntergeladen werden kann. Geben Sie dafür die Artikel-Nummer 04004713 in die Suche ein.
Die Broschüre enthält einen "Hinweis zur Ergänzung der Patientenverfügung im Fall schwerer Erkrankung", der aus der Beratungspraxis in der Palliativ- und Hospizarbeit entstanden ist. Am Ende der Broschüre befindet sich ein Vordruck für eine Karte, die über die Existenz einer vorsorglichen Willensbekundung informiert, Ansprechpersonen nennt und in den Ausweispapieren mitgeführt werden kann. - Deutsche Bischofskonferenz, Rat der Evangelischen Kirche und Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen: Diese 3 Vereinigungen haben gemeinsam die Broschüre "Christliche Patientenvorsorge durch Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Behandlungswünsche und Patientenverfügung" herausgebracht. Die Broschüre nimmt auf christliche Glaubensgrundsätze Bezug.
Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise
Sie haben Fragen zur palliativen Versorgung? Wir sind für Sie da.
So erreichen Sie unsere Ärztinnen und Ärzte:
- am Telefon kostenlos unter 0800 – 420 30 40, täglich von 8 bis 20 Uhr
- per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)
krebsinformationsdienst.med: Service für Fachkreise aktuell – evidenzbasiert – unabhängig
Sie betreuen beruflich palliativ versorgte Patientinnen und Patienten und haben Fragen? krebsinformationsdienst.med unterstützt Sie bei Ihren Recherchen und vermittelt Informationsmaterial. Der Service steht Ihnen von Montag bis Freitag zur Verfügung:
- telefonisch von 8 bis 20 Uhr unter 0800 – 430 40 50
- per E-Mail an kid.med@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)
Quellenhinweis
Viele für diesen Text relevante Quellen sind direkt in den entsprechenden Abschnitten genannt und verlinkt.
Informationen zur Notvertretungsregelungen und vorsorglichen Willenserklärungen finden Sie auf Ihre Vorsorge, eine Internetseite der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (abgerufen am 20.4.2023)
Weitere Themen
Erstellt: 10.05.2023
Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Verantwortlichkeiten in der Redaktion.
Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.